Mein Name ist Rudolf Wachter. Ich wohne seit meiner Pensionierung da, wo ich schon als kleiner Junge Feriengast in 3. Generation war: in Monstein. In der Jugend war ich bei der Winterthurer Pfadi lange sehr aktiv, spielte Geige und Bratsche in verschiedensten Formationen, ging sehr gern ins Gymnasium (Latein und Mathematik waren mit Abstand meine liebsten Fächer), sang in Chören und leitete später auch selber immer wieder kleine Chöre. Da sah ich noch etwas jünger aus:
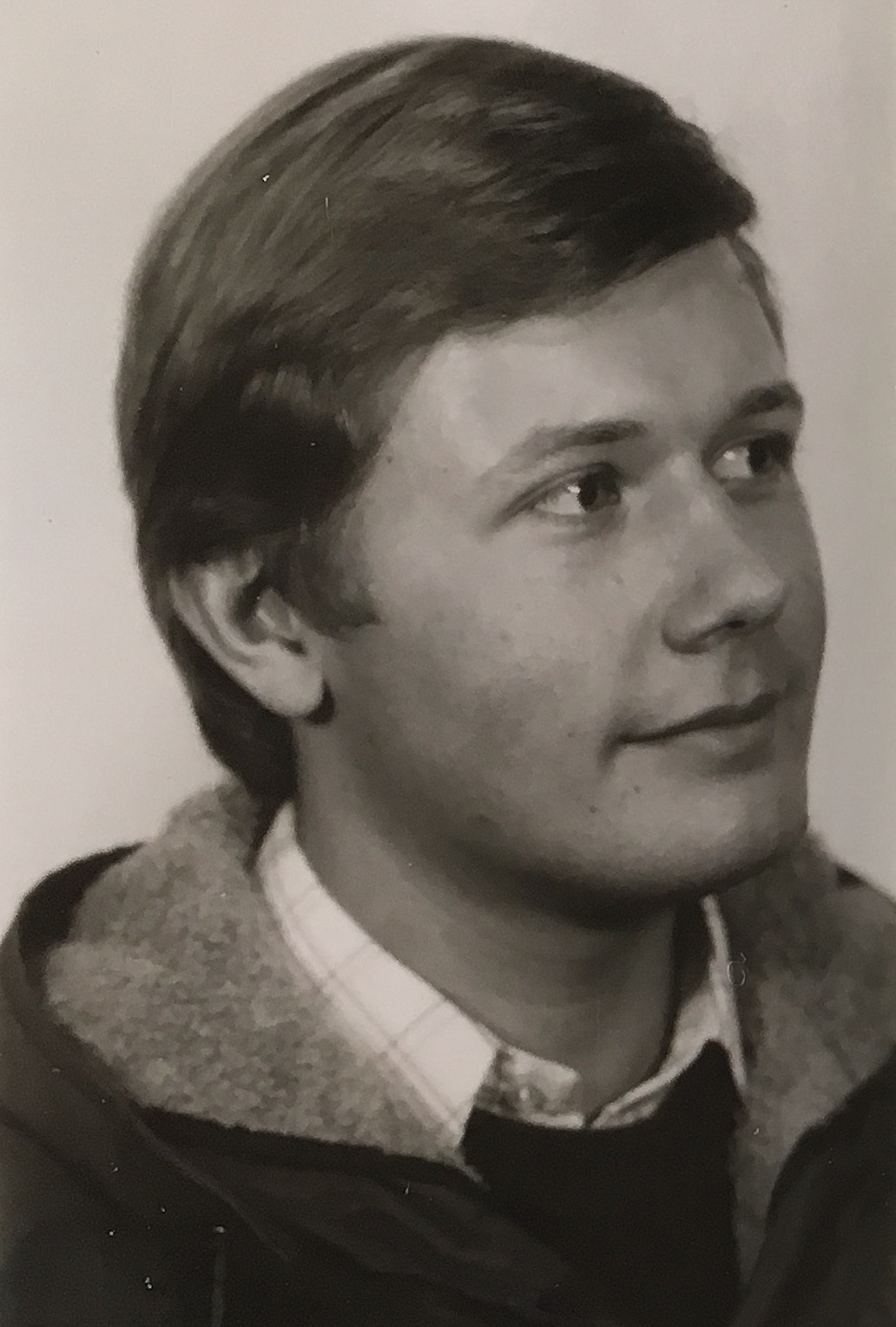
Eines meiner Hobbys, die alten Sprachen (Griechisch und Latein und noch ein paar weitere) machte ich dann zu meinem Beruf: Ich studierte in Zürich und in Oxford (da lernte ich gut Englisch) und wurde schliesslich für ein paar Jahrzehnte Professor für Historisch-vergleichende Sprachwissenschaft an den Universitäten Basel und etwas später auch in Lausanne (und ja, da lernte ich auch noch ganz passabel Französisch). In diesem Teilbereich der Sprachwissenschaft geht es vor allem darum, wie sich die Sprachen entwickelt haben, woran man ihre Verwandtschaft erkennt (wenn sie überhaupt nachweislich verwandt sind) und wie man diese Erkenntnisse für die Sprachdidaktik und die Verbesserung der eigenen Sprachkompetenz nutzen kann.
Meine Hauptforschungsgebiete sind die lateinische, griechische und indogermanische Sprachwissenschaft. Besonders fasziniert hat mich aber immer auch die antike Epigraphik, also die Beschäftigung mit meist kurzen, dafür aber authentischen, also nicht durch fortgesetztes Abschreiben erhalten gebliebenen Schriftzeugnissen aus jenen Epochen. Solche antiken Inschriften zu entziffern und so gut wie möglich zu verstehen macht mir einen Riesenspass. Deshalb habe ich über die Wandinschriften von Pompeji gleich ein ganzes Büchlein publiziert (mit ziemlich vielen neuen Lesungen und Deutungen). Auch zur Geschichte des Alphabets, dieser genial einfachen Schrift, habe ich viel geforscht. Die meisten kleineren Publikationen von mir stehen auf academia.edu zur Verfügung.1
Daneben habe ich aber noch weitere Steckenperde, die – wen erstaunt’s? – fast alle mit Schrift und Sprache zu tun haben. Eines ist das hiesige Tafaaser Projekt, für das mir meine «lebenslang erworbenen Skills», wie das heute heisst, die Arbeit sehr erleichtern: erstens um die alten Handschriften zu entziffern und zweitens um das damals hier übliche Schriftdeutsch (und in den Kirchenbüchern da und dort auch ein wenig Latein) zu verstehen. Als Sprachwissenschaftler schaue ich da übrigens immer sehr genau hin. Das lohnt sich! Wer in diesen Skills noch nicht so geübt ist, aber neugierig, findet einiges Hilfreiche und dazu sogar nagelneues, das heisst uraltes, aber seit Jahrhunderten von niemandem mehr gelesenes Textmaterial, um im Projekt mit anzupacken. Den hiesigen Webauftritt habe ich mir übrigens zum 70. Geburtstag geschenkt – samt der Verpflichtung, ihn tüchtig zu füllen. Dass ich dafür die Domain tafaas.ch günstig erwerben konnte (herzlichen Dank, M.A. in C.!), hat mich nicht wenig beflügelt.
Ein anderes Hobby ist ein nicht nachlassender heiliger Zorn über die unnötige, inhaltlich skandalös schlechte und deshalb kontraproduktiv wirkende Rechtschreibreform 1996 und ihre Verschlimmbesserung 2006 durch den «Rat für deutsche Rechtschreibung», die bis heute gilt. Eine Rechtschreibung ist meiner Meinung nach dann gut, wenn man als Leser möglichst nichts von ihr merkt. Schlecht ist sie, wenn einen beim Lesen jedes sogenannt bzw. so genannt oder jede Gemse bzw. Gämse oder jedes seit kurzem bzw. seit Kurzem vom Inhalt des Textes ablenkt, weil man selber eigentlich gerne anders schreibt und sich deshalb jedesmal fragt, warum dieser oder jener saudumme Schreiberling nun ausgerechnet jene bekloppte andere Schreibweise bevorzugt. Deshalb arbeite ich mit Freude und Überzeugung in einer informellen Vereinigung mit, die ich vor ein paar Jahren einmal so charakterisiert habe: «Als im Frühjahr 2006 bekannt wurde, dass der ‹Rat› den faulen Kompromiss von ‹Varianten› zum Prinzip erheben würde, formierte sich in der Schweiz eine der sympathischsten Guerillaorganisationen aller Zeiten mit Namen Schweizer Orthographische Konferenz (SOK), die seither – natürlich ohne jede behördliche Unterstützung – mithilft, den Reformern die Freude an ihrem Werk zu vergällen. Ihr erklärtes Ziel ist, wieder zu einer sprachrichtigen und einheitlichen deutschen Rechtschreibung zu gelangen.» Die SOK ist in letzter Zeit gerade wieder ziemlich aktiv. Auf der Homepage gibt’s viel Lesenswertes. – Hast Du übrigens weiter oben das Wort jedesmal bemerkt? Vermutlich nicht. Dann weisst Du aber wahrscheinlich auch nicht, dass dieses über 450jährige Wort von der Reform 1996 – aus einem oberfaulen Grund, anders kann man das nicht beschreiben – abgeschafft wurde und heute amtlich verboten ist. Auch im Duden existiert es nicht mehr, er belegt es mit einer Art Damnatio memoriae – keine besonders sympathische Verhaltensweise einem harmlosen Wörtchen gegenüber! Und wir, die schreibende und lesende Bevölkerung müssen uns entscheiden: Benützen wir das bewährte Wörtchen weiter, oder hören wir auf die Behörden, die es auf Anraten der Reformer für falsch erklärt haben und seit bald drei Jahrzehnten verzweifelt versuchen, es von Schulzimmern und Amtsstuben fernzuhalten?
Und bevor ich’s vergesse: Musik mache ich natürlich nach wie vor, und nicht zu knapp.
Hier noch die obligate Datenschutzerklärung:
Ich behandle Deine persönlichen Daten vertraulich, entsprechend dem Schweizer Datenschutzgesetz (DSG) und der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Für Fragen in dieser Hinsicht gebe ich gerne persönlich Auskunft.
- Eine einzige Publikation, nämlich meine wegen Corona-Restriktionen zweimal verhinderte Abschiedsvorlesung in Basel, erlaube ich mir, hier zu publizieren. Sie enthält nämlich viele für das Verständnis des Inhalts unverzichtbare Tonbeispiele, die beim Hochladen eines PDFs durch die üblichen Server kaltschnäuzig gelöscht werden. Ich habe bei academia.edu reklamiert, die Techniker konnten das Problem nicht lösen. Auch auf dem hiesigen Server hat es nicht funktioniert. Es blieb mir also nichts anderes übrig, als den ganzen Text auf eine Webseite zu kopieren (in html) und die Tonbeispiele am richtigen Ort einzubauen. Das sieht etwas weniger hübsch aus, funktioniert aber ganz gut. Die Vorlesung ist über diesen Link zu finden. – Ich hielt dann übrigens etwas später noch eine zweite, unvirtuelle Abschiedsvorlesung und berichtete darin bereits über meine Tafaaser Forschungen, nämlich über die DNR!
↩︎
